Hier wird nicht geterrort

 Zitat von Corti
Zitat von Corti

es gibt Menschen, die sind von Grund auf ein Arschloch.
...
+1
Es gibt sie einfach, diese Menschen die ein Ziel verfolgen und es auf die einfachste Art und Weise erreichen möchten - in dem man lügt, betrügt und korrumpiert. Ich kenn genug Leute, die sind aber auch ohne ersichtlichen Grund öhm...voll die bösen Buben. Trotzphase? Pubertät? Midlifecrisis? Aus Spaß an der Freude? Depression wegen mangelndem Erfolg? Neid? Das reicht alles schon völlig um was böses zu machen. Umso böser und brutaler die Tat, um so dramatischer wird das Enden. Vom Bein stellen über versuchten Todschlag bis zum Genozit ist da alles mit dabei.
Vor einigen Wochen stand in der Zeitung das eine Mutter ihr Kind hat verhungern lassen - sie ist zu ihrem Freund gegangen weil ihr das Geschrei auf den Senkel ging. Purer menschlicher Wahnsinn, den ich so z.B. auch aus Silent Hill - Spielen kennen gelernt habe, obwohl da auch noch eine andere Komponente mitspielt: Radikale Taten im Namen der eigenen Religion.(vor allem in Teil 3). Das ist der Wahnsinn den ich so liebe. Nicht der "muhaha ich bin so wahnsinnig"-Wahnsinn, sondern der "Ich tue das aus einer ernsthaften Überzeugung und kuck dabei auch ganz ernst"-Wahnsinn. Jedem normalen Menschen ist klar, dass das so nicht geht und kämpft dagegen an. Der Bösewicht aber klammert sich mit so einer überzogenen Leidenschaft daran, dass man an erster Stelle Angst, an zweiter Stelle schon fast Mitleid bekommt.
Wozu gehört eigntlich der völlig Wahnsinnige Antagonist, der noch zurechnungsfähig genug ist, um intelligent und hinterhältig zu handeln? Schwarz oder grau? Schließlich handelt er aus einer Überzeugung heraus, nicht aber aus einer völlig rationalen.
Zitat
). Meine Aussage ist nicht, dass der Anschein eine mächtige Waffe ist, Gut und Böse also dem Zweck dient, die Realität zu verschleiern, bis sie irgendwann durchscheint. Vielmehr rechtfertige ich Gut und Böse als symbolische bzw. abstrakte Konzepte, abseits ihrer moralischen Ursprünge oder als Kondensat derer.

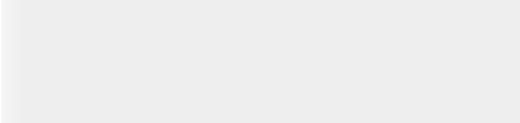





 Zitieren
Zitieren
 )
) 












 "Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht"
"Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht" 
