Also hier mal der relevante Teil des UrhG wie es auf http://www.gesetze-im-internet.de/ur...5BJNG001401377 nachzulesen ist:
Relevant für diese Diskussion sind mMn die §§ 64 ff, die besagen, dass das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des zuletzt verstorbenen (Mit-)Urhebers erlischt. Wichtig ist also nicht der Zeitpunkt an dem das Werk erstellt wurde, sondern der Zeitpunkt, der 70 Jahre nach dem Tod des letzten überlebenden Mitarbeiters liegt.Zitat
EDIT:
Jein. Es käme darauf an, wie hoch ein Richter deinen Eigen-Anteil an der "Gesamt-Schöpfungshöhe" der Collage bewerten würde.

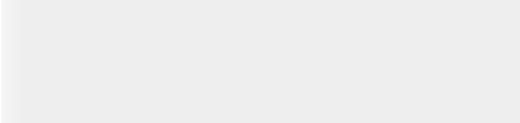




 Zitieren
Zitieren




