Hier wird nicht geterrort

 Zitat von Demo-Boy
Zitat von Demo-Boy

Scheinbar treiben sich hier nur Hobby-Psychologen und Tierflüsterer, aber keine Entwickler herum.
Traurig, traurig...
...
Das eine schließt das andere nicht aus. Bitte nicht verallgemeinern, ich sehe zwei Leute in dieser Diskussion, die in kurzer Zeit quasi Spiele für zwei produzieren 
Letztendlich kommt es aber genau auf die Art des Erzählens im Spiel an, welche Methode denn nun die richtige ist: Möchte ich gern das Gut-und-Böse-Konstrukt, das definitiv in einer schlichten Geschichte funktioniert, oder möchte ich auf eine tiefergehende, realitätsnähere Ebene gehen, die von mir verlangt zu erklären was wer wieso tut. Das muss auch nicht unbedingt kompliziert sein. Wenn ein Bauer sagt "Weil die Wölfe böse sind, reissen sie mir mein Vieh." ist das klarer bullshit. "Die Wölfe suchen meinen Hof heim, weil sie Nahrung suchen." ist okay und verlangt kein tiefes eingehen in die Materie, höchstens der Held ist von der PETA und brennt nach einer langen Schimpftirade und einem Vortrag über die Lebensraumverschiebung von Mensch und Tier lieber den Hof nieder.
Und nur so nebenbei: Dämonen, die zu 80 Prozent für all das Böse auf der Mittelalterlichen Welt verantwortlich sind (wenn man vom damaligen Glauben ausgeht), sind ein Prinzip des absoluten Bösen und handeln in Literatur, Spielen und Filmen oft nicht rational und achten schon gar nicht auf die Folgen ihres Tuns - genau das macht sie doch interessant. Sie sind weder mit Tieren noch mit Menschen gleichzusetzen, und wer das doch tut, sollte schon ganz genau erklären was sie denn dann trotzdem noch vom normalen Tier und vom normalen Mensch so unterscheidet. Bis auf die obligatorische Bindehautentzündung.
Geändert von Sabaku (29.03.2014 um 16:04 Uhr)

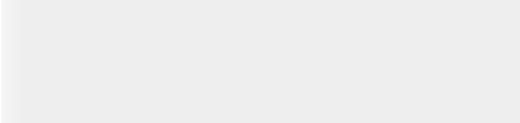




 Zitieren
Zitieren

 Ich habe meinen Bastelkeller auch nicht einfach nur so! Ich hab' Gründe! Hohe Gründe! Kannst meinen Anwalt fragen, der sieht's genauso!
Ich habe meinen Bastelkeller auch nicht einfach nur so! Ich hab' Gründe! Hohe Gründe! Kannst meinen Anwalt fragen, der sieht's genauso!










