Das ist der vernünftigste Ansatz.Zitat von La Cipolla
Jein, inhaltlich vielleicht, aber selbst das ist streitbar. Viele Märchen, wie "Das Mädchen mit den Zündhölzern" und andere Andersens, finde ich wenig kindgerecht. Gerade Kunstmärchen zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie eine Bedeutungsebene haben, die oft nur Erwachsene verstehen. Außerdem sind sie sprachlich sehr ausgefeilt. Beides nicht der Schwarz-Weiß-Malerei zum Trotz - es ist ihr zu verdanken. Worauf es mir bei Märchen ankommt: Sie sind sehr homogen. Welt, Charaktere, Ereignisse und Sprache sind nicht voneinander zu trennen.Zitat
Wie real Troll schreibt: Es ist nötig, seinen Stil der Intention anpassen zu können. Wenn man sich nur für Realismus interessiert, ist das ok. Wenn man nur zu ihm imstande ist, ist das schade. Wenn man nur zu ihm imstande ist und den Rest verurteilt, macht mich das wütend. Aber nicht so wütend, dass ich meinen Schaukelstuhl verlassen möchte. Also gar nicht.
Menschen sind zu so toller Abstraktion fähig und ihr Unterbewusstseins ist voll von Symbolen, wieso also sollte man sich vor allem, außer seiner bewussten Wahrnehmung verschließen? Das ist so, als hätte es die Kunstgeschichte seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht gegeben.

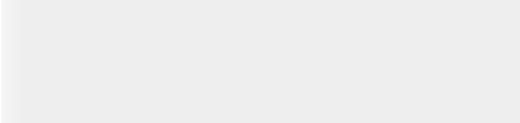





 Zitieren
Zitieren