Die Kunstebene, auf der man dann Kritik hören möchte, müsste aber schon im Vorfeld konturiert werden. Früher (ganz sicher noch bis zum Impressionismus) wäre das vielleicht noch möglich gewesen, indem man Künstlerisches als über das Alltägliche hinausweisend und der Ästhetik verpflichtet ausgegeben hätte. Nur hat sich das eben entscheidend gewandelt. Die Kunst hat oft nichts mehr Verbindliches. Das macht sie einerseits freier, das macht Kritik aber auch oft gegenstandslos. Allenfalls hat sich der künstlerische Anspruch erhalten, der Wahrnehmung des Betrachters (neuer: des Teilnehmers; insofern passten Spiele durchaus zur Kunst) neue Perspektiven zu eröffnen. So verschwurbelt abstrakt lässt sich das allerdings ebensogut als Allerweltsphrase verwenden. Was alles heißen kann, meint oft gar nichts.
Wenn die Spielkunst an adäquater Kritik interessiert ist, müsste sie die Kriterien mitliefern. Um im Spielejargon zu bleiben: eine Komplettlösung im Sinne einer Deutungshilfe. Die kann die Auseinandersetzung, den Interpretationsversuch natürlich reizlos machen. Aber sie kompensierte den zu erwartenden Mangel an Erfahrenheit, immerhin reden wir über Makerspiele und so willkürlich der Kunsbegriff zuweilen sein mag, das Publikum für Makerspiele ist konkret (jung; im Durchschnitt nicht mit dem Bedeutungssprech der Galeristen vertraut; kennt die Referenzen kaum). Blöd nur, wenn der Künstler argwöhnt, jede Erklärung könne sein Werk entzaubern oder wenn er sich zu fein für Hilfestellungen wähnt. Ich denke, Spielkunst in der Makerszene setzt gerade auch vom Entwickler sehr viel Kooperationswillen voraus und verlangte ihm dadurch etwas für etabliertere Bereiche des Kunstbetriebes Ungewöhnliches ab. Ein wenig drohte dadurch auch der Verlust von Aura, indem der Künstler gucken ließe, wie viel Handwerk hinter seinem Treiben steckt. Eventuell ist der Preis dann doch zu hoch.
@ Kelven
Sehe ich auch so: Entwickler kritisieren oft viel schärfer als Spieler. Ich glaube aber nicht, sie kaschierten damit hauptsächlich versteckten Neid oder versuchten, der eigenen Angst vor einer künftigen Nischenexistenz mit einer Bedeutungsoffensive zu begegnen. Vielmehr meine ich, ein Bastler mache sich einfach durch die ständige, tätige Auseinandersetzung mit seinem Tun naturgemäß mehr Gedanken und sei entsprechend anfälliger für wirklich richtige Supertheorien, die er dann auch prägnant und ausformuliert zu präsentieren weiß, während es der weniger durchdachte Spieler lässiger angehen lässt.

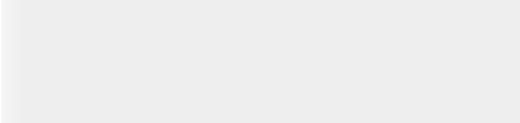




 "Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht"
"Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht" 

 Zitieren
Zitieren