Geschichten mit einem klaren Guten und Bösen verströmen für mich romantische Behaglichkeit. Wenn der Schurke böse lacht, während er das Dorf samt Bauern niederbrennt, hat das was von Kuschelrock. Ich lasse mein Feuerzeug aufschnippen und wippe wohlig mit. Luke Skywalker muss blond sein und wenn er vom ruchlosen Trachten des Imperiums erfährt, muss in seinen Augen ideale Naivität aufscheinen. Und natürlich muss der böse Imperator eine schwarze Kutte tragen, die tückische Augen und schlechte Zähne birgt. Auf eine gänzlich ironiefreie Weise mag ich das.
Solche Geschichten fallen in sich zusammen, sobald spöttischer Abstand einzieht. Wer als Erzähler unfähig zum Pathos ist, sollte davon die Finger lassen; derartiges liegt dann außerhalb seines Könnens. Der hohen Kunst des Schwarz-Weiß kann man sich dann allenfalls mit der Krücke der Parodie nähern. Ich schaffe das beispielsweise nur so. Damit gehen Nachteile einher. Man kann nur vom Abglanz der Klischees schmarotzen, sie aber nicht direkt anzapfen. Und selbst ein neues Klischee zu erschaffen, also den Gipfel der Kreativität zu erringen, weil die eigene Fantasie in diesem Fall die Vorstellung der Vielen prägte, fällt dann auch weg.
Allerdings lassen moralisch klare Konturen kaum Heldenpersönlichkeiten zu. Man ist auf Archetypen angewiesen, das dramatische Personal fungiert sehr zweckrational als Gefäße sittlicher oder unsittlicher Prinzipien. Auf der popkulturellen Ebene: Selbst Indiana Jones hat mehr Ambivalenz als die Gefährten im Herrn der Ringe (Boromir ist wohl nicht zufällig der am ehesten in Erinnerung bleibende Charakter des ersten Films). Prinzipiell überlegen ist keine der beiden Erzählweisen. Sie funktionieren je anders und das sollte man sich vor Augen halten, bevor man sich das erzählerische Mittel aussucht, das am besten dem eigenen Zweck dient. Hier stimme ich Owly zu: ein Märchen als post-existenzialistisches Selbstbetrachtungsstück aufzuziehen, verwandelte es in ein saft- und kraftloses Ding.

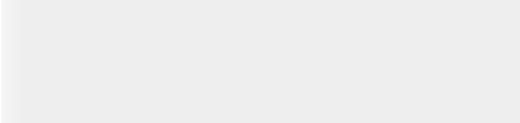




 "Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht"
"Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht" 

 Zitieren
Zitieren