@ Mordechaj
Das ist sehr konstruktiv gedacht, aber ich denke, wenn man die Dystopie wieder zur Utopie umbiegen möchte, übergeht man das lustvolle Spiel mit dem Gegenteil. Natürlich redest du auch nicht von einer Reform zurück zum Naturzustand des Rosseau'schen Kinderlachens, eher schon zurück zum Wolfsgeheul Hobbes'. Aber wenn das Böse durch die äußeren Urzustände nun wieder unmittelbar würde, wäre die Zivilisation in diesem Gedankenbild der (vorübergehende) Schutzpanzer. Hingegen ist sie in der Dystopie nur ein wechselndes Gefäß des Bösen. Die Zivilisation implodiert dort wegen ihrer selbst und der erzählerische Reiz der endzeitlichen Folgen folgt meist aus dieser Grundfigur. DayZ wie Mad Max stellen keine Reset-Szenarien dar, keinen Rücksprung, keinen neuen Startversuch. Sie erzählen vom Ende als Fortsetzung, denn die verbliebenen Akteure werden von den Resten des Einstigen genährt. So, wie sie unfähig sind, davon zu lassen und all ihr Trachten darum kreisen lassen, bleiben sie verflucht. Das ist nicht nur pessimistisch und mit einiger Angst vor der Entwicklung seit der Industrialisierung beschwert, es ist auch esoterisch und damit auf die richtige Art lächerlich, die es für erzählende Spiele wertvoll machen kann. Mit einer guten Portion Verdammnis und Weihrauch bleibt das Böse in meinen Augen interessanter als eine psychologisierende Deklinationstabelle.

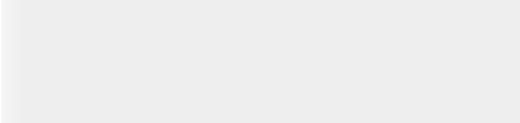


 "Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht"
"Wolfenhain" fertig. "Endzeit": fertig. Neues Projekt: "Nachbarlicht" 

 Zitieren
Zitieren
