Da stimme ich völlig zu, das wäre auch ein fragwürdig übertriebener Anspruch. Es geht mir auch eher um die quasi psychologische Wirkung, also das Warum? der dramaturgischen Funktionabilität. Ich denke, das Böse wird auf Erzähl- und Erfahrungsebene reizvoll, weil es -- verhelfs des ewigen Triumphierens des Guten -- den Exorzismus zulässt. Die Auslöschung hat befreienden Charakter. Gleichzeitig hat aber auch die Erfahrbarmachung und Annäherung ihren Reiz, die Domestikation des Bösen verleiht Macht und Bildungscharakter. Beides erfüllt psychologisch teilweise sogar offenliegende Bedürfnisse des Rezipienten, im ersten Fall die (Selbst-)Überwindung, in zweiterem die Selbstpotenzierung bzw. die Potenzierung der Welt. Zwei grundsätzlich positive Urerfahrungen: Einmal der Sieg durch Vernichtung, ein andermal das Lernen und Weiterentwickeln (das letztendlich ebenfalls ein Abtöten des Überwundenen einschließt). In beiden Fällen lässt sich seine grundsätzliche (Um-)Ordnung erreichen, entweder durch Reinstallation (Beheben des ordo-Bruchs), ein andermal durch Reorganisation (Abschluss einer Entwicklung zum neuen Ganzen). Im Auslöschen der bösen Andersartigkeit kommt der Rezipient dann, den Protagonisten stellvertretend, für eine Weile zur idealen Gänze; im Domestizieren und Übersteigen des bösen Störenfrieds macht er die beruhigende Erfahrung der Veränderlichkeit -- stellvertretend für die Erzählwelt.
Und da gibt es natürlich Zwischennuancen und Mischverhältnisse, die auf das anvisierte Publikum abgestimmt sein wollen. Dennoch sind beide Erfahrungen grundständig.
Für die Makerpraxis: Das Böse ist urtümlich böser in einer Bürgerkriegsgeschichte als in einer Erzählung über zwei verfeindete Königgreiche.[/QUOTE]Zitat
Hier aber gerade sehe ich den Punkt: Die Zuschreibungen sind (wie so oft) arbiträr und kontextbasiert. Was unterscheidet denn unser Verständnis von Böse von dem anderer Kulturen? Genau, vor allem das Verständnis des Eigenen, die Definition der eigenen Sphäre und des eigenen Sozialverbandes. Die Konstruiertheit des ethischen Bösen schlägt sich dort nieder, wo ihm kulturelle Zuschreibungen eingeflöst werden, die dadurch innerhalb dieser Kultur beinahe untrennbar mit der Ahnung vom Urbösen verbunden sind. Und auch dieses Konstrukt ist wieder kontext- und nutzenabhängig; beispielsweise ist Mord in jeder Gesellschaft völlig anders definiert, teilweise sogar spaltet dieses Definitionsproblem neue Gruppen in diese Gesellschaft. In manchen ist der Ritualmord alltäglich Gutes, die Todestrafe Erhaltungswerkzeug einer etablierten Ordnung. Jede Gesellschaft definiert sich, was sie für schützenswert erachtet -- Ist es das Leben? Welches und wessen Leben? --, ein Verstoß gegen diese konstruierten Kleinodien ist dann ethisch verwerflich. Das gilt auch für Vertrag und Vertrauen, denn auch diese haben nur intrinsischen Wert, nicht aber über die Grenzen der Sphäre des Eigenen hinaus: Klar, sie sind ja gerade die Konstituenten des Sozialverbandes.
Ich glaube im Übrigen, wir reden ohnehin gerade über dasselbe und sind eigentlich ganz ähnlicher Meinung, haben da nur einen anderen Wortschatz. Das Konstruierte steht immer im Kontext der jeweils eigenen Sphäre und kommt inklusive eines Konzeptes vom "Anderen" (hebr. שטן satan: "Gegner"; die Nebenbedeutung "Ankläger" kommt aus dem semitischen Gerichtswesen, wo einer dem anderen gegenüberstand) und lässt ihm Gefährdungscharakter angedeihen (griech. διάβολος, diábolos: "Entzweier", "Störer", "Verderber", "Verdreher"; mit διά durch [in der griechischen Multikonnotation], βάλλω werfen, aber auch: gestürzt werden --> "Gefallener", "Verstoßener"; es handelt sich bei διάβολος um ein Wortspiel en façon der mündlichen Tradition im östlichen Mittelmeerraum). Das Andere, Fremde, ist immer bedrohlich -- bis man global denkt.
Auch hier würde ich gern eine Unterscheidung zwischen dem ethischen Bösen und eben dem Urbösen vornehmen. Viele Attribute des Bösen sind nämlich alles andere als bewusst -- beispielsweise das Hässliche und Bedrohliche, Monströse. Ob wir uns da jetzt einbilden, es handle sich um evolutionär potente Überbleibsel der ersten Säugetiere, die noch den fetten Mäulern von Dinosauriern durch instinktive Angstreaktionen entrinnen mussten, oder ob wir darin ein grundlegend gesundes Verteidigungsverhalten sehen, bleibe erstmal außen vor. Das ethische Böse jedenfalls ist bestens noch eine Umlagerung der kulturellen Vorstellung von Verwerflichem auf das grundständige Urböse. Beides ist aber immer noch trennbar, das bedrohliche, unmotivierte Urböse mit all seinen Konsequenzen noch unbewusst verdauert.

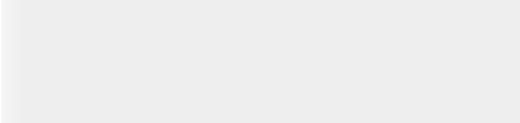






 Zitieren
Zitieren