 Zitat
Zitat
Ro|man|tik die; - <zu romantisch u. 2...ik (2), Analogiebildung zu Klassik>: 1. Epoche des europäischen, bes. des deutschen Geisteslebens, der Literatur u. Kunst vom Ende des 18. bis zur Mitte (in der Musik bis zum Ende) des 19.Jh.s, die in Gegensatz zu Aufklärung u. Klassik stand u. geprägt ist durch die Betonung des Gefühls, die Hinwendung zum Irrationalen, Märchenhaften u. Volkstümlichen, durch die Rückwendung zur Vergangenheit. 2. a) durch eine schwärmerische od. träumerische Idealisierung der Wirklichkeit gekennzeichnete romantische (2) Art; b) romantischer (2) Reiz, romantische Stimmung, romantische Bewegung; c) abenteuerliches Leben.
Quelle: DUDEN - Das große Fremdwörterbuch
Romantik, die; - [zu romantisch (2), geb. in Analogie zu Klassik]:
1. a) Epoche des europäischen, bes. des deutschen Geisteslebens vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jh.s, die in Gegensatz stand zu Aufklärung u. Klassik u. die geprägt ist durch die Betonung des Gefühls, die Hinwendung zum Irrationalen, Märchenhaften u. Volkstümlichen u. durch die Rückwendung zur Vergangenheit: die deutsche, englische, französische R.; die [Blüte]zeit, die Malerei der R.; in, seit der R.; b) die romantische Bewegung: die jüngere, ältere, die Heidelberger, Jenaer R.; die blaue Blume der R. (Blume 1 b). 2. das Romantische (2 b), die romantische (2 b) Stimmung o. Ä., die einer Sache anhaftet: die R. der Landschaft, eines Sonnenuntergangs; die süßliche R. des Films widerte ihn an; das Leben der Schiffer hat seine R. längst verloren; keinen Sinn für R. haben; sie schwärmten von der R. des Wanderlebens.
Quelle: DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch
Romantik die, geistige Strömung, die im 18. Jh. von England ausging (T. Gray, E. Young), von J. J. Rousseau wichtige Impulse erhielt und Aufklärung und Klassizismus ablöste (in Dtl. übernahm diese Rolle zunächst der Sturm und Drang); durch die Ausbildung nat. Literaturen hatte die R. v. a. in Ost- und Südosteuropa auch polit. Bedeutung. Romantisch bedeutete urspr. »romanhaft«, »fabulös«, wurde dann zum Begriff des Gefühlvollen, Ahnungsreichen, im Ggs. zum Verstandesmäßigen. Die künstler. Formen wurden oft aufgelöst: Vorliebe für das Fragment, Verbindung der versch. Künste und der einzelnen Dichtungsgattungen. Am unmittelbarsten äußerte sich die R. in Dichtung, Musik, Malerei, wirkte jedoch auch in Philosophie und Wiss. Wesentl. Elemente romant. Kunstäußerung sind ausgeprägtes Naturempfinden, Entwicklung des Geschichtsbewusstseins, Betonung des Unheimlichen und Dämonischen. Innerer Zerrissenheit begegnen die Künstler mit melancholisch-sentimentaler Haltung (»Weltschmerz«). Ihre typ. Ausprägung und ihren Höhepunkt erreichte die R. in Dtl. (um 1800 bis etwa 1830): In der Früh-R. (Mittelpunkt Jena, dann Berlin; Novalis, die Brüder A. W. und F. Schlegel, L. Tieck) führte die romant. Haltung z. T. zu ausgeprägtem Subjektivismus. Ausdruck der als schmerzlich empfundenen Diskrepanz zw. dem Endlichen und dem Unendlichen ist die romant. Ironie. Die Hoch-R. (Zentrum Heidelberg) entwickelte die Überzeugung, dass die schöpfer. Kräfte im Volksgeist und seinen Äußerungen Sprache, Dichtung usw. zu suchen seien (Wiedererweckung von Märchen, Sage, Volkslied durch C. v. Brentano, A. v. Arnim, die Brüder J. und W. Grimm, J. v. Eichendorff). Weitere literar. Zirkel entstanden in Dresden und Berlin (R. Varnhagen v. Ense, A. v. Chamisso, E. T. A. Hoffmann). Zur süddt. oder schwäb. R. gehören u. a. L. Uhland und W. Hauff. Vertreter der Spät-R. ist u. a. N. Lenau. - Die romant. Malerei drückt ein individuelles Naturgefühl aus, in dem Mensch und Natur eine innige Beziehung eingehen (P. O. Runge, C. D. Friedrich, J. Constable u. a.).
Quelle: Der Brockhaus in einem Band
Frühromantik, die:
Anfangsjahre der literarischen Epoche der Romantik.
Quelle: DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch
Ro|man|ti|ker der; -s, -: 1. Vertreter, Künstler der Romantik (1). 2. Fantast, Gefühlsschwärmer.
Quelle: DUDEN - Das große Fremdwörterbuch
...
)
)

 Kontrollzentrum
Kontrollzentrum





 Zitieren
Zitieren










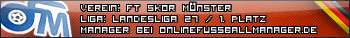




 <3 sind nicht zwan)
<3 sind nicht zwan) )
)
 (n Onenightstand???)
(n Onenightstand???)